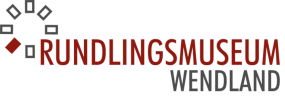Die Flachsarbeitung war keine einfache Sache. Rund dreizehn Arbeitsschritte mussten nach der Erne des Flaches vollführt werden, um am Ende einen gebleichten oder gefärbten Ballen Leinen zu erhalten. Für das Wendland – sowie für andere Regionen in Niedersachsen – bedeutete das in Heimarbeit hergestellte Leinen die einzige Einnahmequelle neben der Landwirtschaft. In der kleinen Ausstellung in dem historischen Speichergebäude werden die einzelnen Arbeitsschritte anhand von Ausstellungsobjekten und Erläuterungstafeln dargestellt.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts führte die Flachsverarbeitung zu beträchtlichem Wohlstand im Wendland. Die prächtigen Vierständerhäuser mit ihren geschnitzten Giebeln zeugen davon.
Die Flachs- oder Leinensaat wurde traditionell am 100.ten Tag des Jahres ausgebracht, also Anfang April. Bis aus der zart-blau blühenden Leinenpflanze gewebtes Leinen wurde, war eine Vielzahl von Arbeitsschritten notwendig. Es begann damit, dass das Feld nach der Aussaat bis zur Ernte absolut unkrautfrei gehalten werden musste. Ab Juli wurde dann geerntet. Um möglichst keinen Verlust zu haben, wurden die Leinenpflanzen nicht gemäht, sondern als Ganzes ausgerissen. Ähnlich wie beim Getreide wurden die Pflanzen dann in Bündeln zum Trocknen aufgestellt.
In der Baakstav wurde der im Wasser der Rötekuhle angerottete Flachs auf den Wänden aufgestellten Lattenrosten mit Hilfe eines kleinen Ofens (Spitschky genannt) gedörrt und anschließend der Flachs per Handbraake gebrochen.
Danach war es die langwierige und monotone Arbeit Tätigkeit des Spinners, die Flachsfasern zu Garn zu verdrehen. Sie fand überwiegend in der dunklen Jahreszeit statt. Seit dem 17. Jahrhundert waren dafür Spinnräder in Gebrauch. Das gesponnene Garn wurde auf Spulen gewickelt.




In beinahe jedem wendländischen Bauernhaus stand ein Webstuhl. Man webte Leinen für den eigenen Bedarf, vor allem aber für den Verkauf.
Damals durfte Leinen nur verkauft werden, wenn es amtlich geprüft war. Um ein Gütesiegel der Aufsichtsbehörde, der sogenannten „Legge“ zu bekommen, musste man die gewebte Ware den Leggenmeistern in Lüchow, Wustrow, Bergen a. d. Dumme oder Dannenberg vorlegen. Bevor diese ihren Stempel auf den Ballen drückten, kontrollierten sie genau, ob das Material korrekt gesponnen und gewebt war. Die „Leggen“ im Wendland erzielten zeitweise den höchsten Leinenumsatz im ganzen Königreich Hannover.

Webstuhl 
Webstuhl 
Spulenständer 
Spulrad 
Riffelkamm mit Flachs 
Brechmaschine
Fotos: Boni Goldlücke, Archiv Rundlingsmuseum Wendland